Zahlreiche Bücher sind in den letzten 35 Jahren erschienen, die die Zeit der zweiten deutschen Diktatur im 20. Jahrhundert aufarbeiten. Auch Christen haben sich daran beteiligt. Hier legen sie ein interessantes Werk vor, das über die Erfahrungen von sechs Personen in und mit der früheren DDR berichtet.
Der Pfarrerssohn Thomas Begrich musste sein Theologiestudium an der Uni Halle abbrechen, weil er den Wehrdienst verweigerte. Über die Stationen Hilfsarbeiter, Abteilungsleiter für Wirtschaftskontrolle und Verwaltungsleiter an einem kirchlichen Krankenhaus arbeitet er sich (nach der Wende) hoch bis zum Leiter der Finanzabteilung des Kirchenamtes der EKD. In den ereignisreichen Monaten der zweiten Jahreshälfte von 1989 engagiert er sich im Neuen Forum und setzt sich für die Friedliche Revolution ein. Natürlich wird er bespitzelt. Doch Begrich geht seinen Weg im festen Vertrauen auf Gott und ist auch bereit, den auf ihn angesetzten Mitarbeitern der Stasi zu verzeihen.
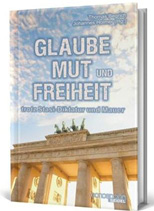 Der katholische Christ Willi Kraning, der 1931 in Hagen geboren wird und sich noch an die Nazi-Diktatur erinnern kann, geht nach Abschluss seines Theologiestudiums in Paderborn freiwillig in die DDR und wird 1956 in Magdeburg zum Priester geweiht. Kraning lässt sich vom religionsfeindlichen DDR-System nicht einschüchtern. Gewissenhaft tut er die Arbeit eines Seelsorgers. 1987 wird er nach Genthin versetzt. Dort lernt er den evangelischen Christen Thomas Begrich kennen. Beide arbeiten in den Wochen der Wende im Herbst 1989 eng zusammen. Kraning stellt seine Kirche für Friedensgebete zur Verfügung. Nie zuvor war das Gotteshaus so voll. Am 1. November kommen über 6.000 Menschen in der Kirche und auf dem Markplatz zusammen. Alles verläuft friedlich. Nach der Wende arbeitet Kraning weiter als Seelsorger, setzt sich zugleich aber auch erfolgreich für den Erhalt von Arbeitsplätzen ein, sodass es bald heißt: „Wenn du in Genthin ein Problem hast, wende dich an den katholischen Pfarrer.“ (S. 155)
Der katholische Christ Willi Kraning, der 1931 in Hagen geboren wird und sich noch an die Nazi-Diktatur erinnern kann, geht nach Abschluss seines Theologiestudiums in Paderborn freiwillig in die DDR und wird 1956 in Magdeburg zum Priester geweiht. Kraning lässt sich vom religionsfeindlichen DDR-System nicht einschüchtern. Gewissenhaft tut er die Arbeit eines Seelsorgers. 1987 wird er nach Genthin versetzt. Dort lernt er den evangelischen Christen Thomas Begrich kennen. Beide arbeiten in den Wochen der Wende im Herbst 1989 eng zusammen. Kraning stellt seine Kirche für Friedensgebete zur Verfügung. Nie zuvor war das Gotteshaus so voll. Am 1. November kommen über 6.000 Menschen in der Kirche und auf dem Markplatz zusammen. Alles verläuft friedlich. Nach der Wende arbeitet Kraning weiter als Seelsorger, setzt sich zugleich aber auch erfolgreich für den Erhalt von Arbeitsplätzen ein, sodass es bald heißt: „Wenn du in Genthin ein Problem hast, wende dich an den katholischen Pfarrer.“ (S. 155)
Johannes Holmer berichtet in seinem Beitrag davon, wie Erich und Margot Honecker für einige Monate im Hause seines Vaters Uwe Holmer Aufnahme finden. Niemand wollte den entmachteten Staatsratsvorsitzenden aufnehmen; daher bat man Pastor Holmer, dem Ehepaar Honecker in seinem Pfarrhaus „Asyl“ zu gewähren. Innerhalb kurzer Zeit werden Uwe Holmer und seine Ehefrau weltberühmt. Doch sie sehen sich auch manchen Anfeindungen von Bürgen ausgesetzt, die es unerträglich finden, dass der Mann, der ein ganzes Volk knechtete, nun in einem Pfarrhaus lebt. Auch für Familie Holmer war der Schritt nicht leicht, denn Margot Honecker war als ehemalige DDR-Bildungsministerin dafür verantwortlich, dass die Kinder von Holmer kein Studium aufnehmen konnten. Doch als Christen gilt für sie das Gebot der Nächstenliebe, das auch die Feinde einschließt, sowie die Bitte aus dem Vaterunser: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Begrich, Thomas und Johannes Holmer (Hg.): Glaube, Mut und Freiheit – trotz Stasi-Diktatur und Mauer. Hammerbrücke: concepcion Seidel 2024. 333 S. Hardcover: 19,95 €. ISBN: 978-3-86716-270-8
Der frühere Leiter der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, Helmut Matthies, beschreibt in seinem Artikel, wie die Stasi versuchte, die Arbeit der Kirchen zu unterwandern. Damit beschränkte sie sich keineswegs nur auf die Kirchen in der DDR, sondern wusste auch in den Kirchen der Bundesrepublik ihre Mitarbeiter zu platzieren. Ein besonderes Augenmerk richtete die Stasi auf christliche Missionswerke in Westdeutschland, die Bibeln und christliche Literatur in den kommunistischen Ostblock schmuggelten. Von der Stasi angeworbene Pfarrer konnten sich bei der Kontaktaufnahme mit westlichen Missionswerken (z. B. Licht im Osten) so perfekt als pietistisch-evangelikale Gläubige verstellen, dass ihre dunklen Machenschaften nicht auffielen und manche für den Osten bestimmte Bibeltransporte nie ihr Ziel erreichten. Matthies stellt ernüchtert fest, dass nur wenige IMs sich später für ihr Verhalten entschuldigt haben.
Weil die westdeutsche Theologiestudentin Gerlinde Breithaupt sich in einen ostdeutschen Pfarrer verliebt hatte und dieser seinen Platz im Osten sah, geht sie im Jahr 1981 ganz bewusst dorthin und macht ihr Vikariat in Roßla (Sachsen-Anhalt). Sie beschreibt ihre inneren Kämpfe, wenn sie wieder einmal Zeugin davon wird, wie gute Freunde den Osten verlassen und in die Bundesrepublik ziehen. Doch Breithaupts bleiben auch nach der Wende weiter im Osten. Für kurze Zeit haben sie gehofft, dass die neue Freiheit auch den Kirchen einen Aufschwung bringen wird. Doch die vollen Kirchen im Herbst 1989 leeren sich ganz schnell. Und mit der Einführung der Kirchensteuer (9 % von der Lohnsteuer) verlassen viele Mitglieder ihre Kirche, um Geld zu sparen.
Den letzten Beitrag liefert der Verleger Frieder Seidel, in dessen Verlag das vorliegende Buch erschienen ist. Seidel entstammt einer christlichen Familie im Vogtland und entscheidet sich schon als Kind für den Glauben an Jesus Christus. Weil er Mitgliedschaften in gesellschaftlichen Organisationen der DDR (Junge Pioniere, Freie Deutsche Jugend usw.) ablehnt und auch den Wehrdienst verweigert, bleiben ihm Abitur und Studium versagt. Doch er findet seinen beruflichen Weg und engagiert sich in seiner Freizeit in einer Freikirche. Wegen seiner zahlreichen Kontakte zu Christen aus dem Westen steht er unter ständiger Beobachtung der Stasi. Dennoch gelingt es ihm, sich Freiräume zu erobern. Er reist mehrfach nach Rumänien, um dortigen Christen mit Lebensmittelspenden zu helfen und sie mit christlicher Literatur zu versorgen. Ehrlich beschreibt er seine Angst, an der Grenze aufzufliegen und für mehrere Jahre ins Zuchthaus zu müssen. Doch die Grenzbeamten sind mit Blindheit geschlagen und finden keine Bibeln.
Das Buch zeigt eindrücklich, unter welchen Einschränkungen Christen in der DDR leben und arbeiten mussten, macht aber zugleich auch deutlich, dass christliches und kirchliches Leben möglich war. Allerdings hatten Christen, die ihren Weg kompromisslos gingen, mancherlei Nachteile zu ertragen: Ausschluss von höherer Bildung und einflussreichen beruflichen Positionen, Beobachtung durch Mitarbeiter der Stasi und in Einzelfällen sogar Verhaftung und Gefängnis.
