Das Buch des amerikanischen Psychologen Joseph Henrich hat seit seinem Erscheinen 2021 in den USA viele Diskussionen befeuert. Für Christen ist die Lektüre deswegen wertvoll, weil das Buch im Ergebnis darlegt, wie der christliche Glaube ab dem Mittelalter die westlichen Gesellschaften geprägt hat. Henrich sieht die Entwicklung der Fundamente in der Zeit zwischen 400 und 1400 und den eigentlichen Schub mit der Reformation ab etwa 1500. Es spricht hier allerdings kein gläubiger Wissenschaftler, der das Christentum verteidigen will. Henrich ist eher Atheist, der die Welt ganz aus der Evolutionslehre erklären möchte. Ein größeres Kapitel widmet er dann auch seiner Theorie, wie die Menschen im Rahmen der Evolution zur Idee eines Gottes kamen und wie sie dann Religion entwickelten. Dieser Teil zeigt, dass Henrich dazu neigt, spekulative Ideen, wenn sie nur plausibel klingen, auch ohne Belege zu vertreten.
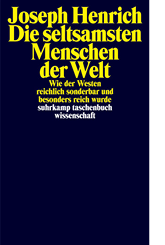 Spannender sind andere Kapitel, in denen Henrich, gestützt auf zahlreiche Untersuchungen aus Psychologie und vergleichender Kulturanthropologie, entfaltet, wie sich die westlichen Gesellschaften entwickelt haben. Dabei zeigt sich, dass fast alles, was sie erfolgreich und attraktiv gemacht hat, aus dem christlichen Glauben gewachsen ist. Henrich hält das für zufällig und unbeabsichtigt. Der Begriff „seltsame Psychologie“ durchzieht das Buch. Es ist die Übersetzung für das englische Wort „WEIRD“, das zugleich als Akronym für westlich, gebildet (educated), industrialisiert, reich und demokratisch steht. Der Begriff trifft die Sache recht gut, weil das Denken und Verhalten in westlich geprägten Kulturen sonderbar erscheint. Es ist weder naheliegend noch gewöhnlich.
Spannender sind andere Kapitel, in denen Henrich, gestützt auf zahlreiche Untersuchungen aus Psychologie und vergleichender Kulturanthropologie, entfaltet, wie sich die westlichen Gesellschaften entwickelt haben. Dabei zeigt sich, dass fast alles, was sie erfolgreich und attraktiv gemacht hat, aus dem christlichen Glauben gewachsen ist. Henrich hält das für zufällig und unbeabsichtigt. Der Begriff „seltsame Psychologie“ durchzieht das Buch. Es ist die Übersetzung für das englische Wort „WEIRD“, das zugleich als Akronym für westlich, gebildet (educated), industrialisiert, reich und demokratisch steht. Der Begriff trifft die Sache recht gut, weil das Denken und Verhalten in westlich geprägten Kulturen sonderbar erscheint. Es ist weder naheliegend noch gewöhnlich.
Henrich identifiziert dafür zahlreiche Gründe. Als wesentlichen Treiber für die meisten Entwicklungen sieht er den Abschied der Gesellschaft von verwandtschaftsbasierten Entscheidungen, Wertvorstellungen und Institutionen. Man könnte sagen, die Gesellschaft überwandt das Clan-Denken, das weithin normal war. Das hatte Folgen, weil Werte nun nicht mehr abgestuft nach Verwandtschaftsgrad galten, sondern für jeden gleich. Weder unser modernes Rechtssystem noch auch der geschäftliche Umgang „auf Treu und Glauben“ wäre sonst denkbar. Henrich sieht den Kampf der Kirche gegen Inzestbeziehungen als Treiber. Für ein funktionierendes verwandschaftsbasiertes Handeln sind Beziehungsgeflechte notwendig, die durch arrangierte Ehen unter Verwandten aufrechterhalten werden. Henrich übersieht, dass das ohne das christliche Verständnis von Kirche als neuer Familie, die über der leiblichen Familie steht, nicht möglich gewesen wäre.
Henrich, Joseph: Die seltsamsten Menschen der Welt: wie der Westen reichlich sonderbar und besonders reich wurde. Suhrkamp Wissenschaft Bd. 2471. Berlin: Suhrkamp, 2025. 920 S. 25,00 €. ISBN 978-351-830-071-8
Bei der wachsenden Bedeutung der Bildung erkennt er den Zusammenhang deutlicher, wenn er auf Untersuchungen verweist, die beweisen, dass insbesondere die Reformation mit ihrer Betonung der Bibel die Lesefähigkeit nachhaltig verbessert hat. Das aber habe das gesamte Denken stark beeinflusst. Lesende Menschen denken meist analytischer, was sie auf bestimmten Gebieten erfolgreicher macht. Positive Wirkungen hatte die Durchsetzung der Monogamie. Hier sind Effekte auch da deutlich, wo die Ein-Ehe in nicht christlichen Ländern eingeführt wurde. Heute sind sich Kulturwissenschaftler und Psychologen weitgehend einig, dass die treue Ehe erheblich positiv wirkt.
Auch die Idee der Menschenrechte ist ohne die christliche Grundlegung nicht denkbar. Für westliche Gesellschaften ist es selbstverständlich, dass jeder Mensch unveräußerliche Rechte hat und dass diese nur unter besonderen Umständen eingeschränkt werden dürfen. Das ist ohne den durch das Christentum beförderten Individualismus unlogisch. Das Christentum bewirkte auch, dass Menschen sich nicht vornehmlich als fremd und feindlich ansahen. Das hatte ein „Positivsummendenken“ zur Folge, sodass wirtschaftlicher Austausch auch den Vorteil des Geschäftspartners im Blick hat. So wurde auch wissenschaftlicher Austausch beschleunigt, in dem sich Forscher gegenseitig fördern.
Das Werk bietet noch viel mehr Material, das zum Verständnis des „christlichen Abendlandes“ beitragen kann. Der psychologische Ansatz hat Grenzen und bräuchte mehr historische Ergänzung. Rund 200 Seiten sind Anhänge und Anmerkungen, die sowohl Belege bieten als auch Hinweise zum Weiterdenken. Die Lektüre lohnt auch, wo sie manchmal weitschweifig wird.
